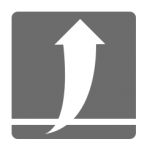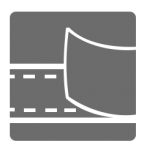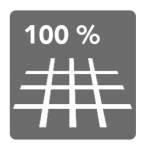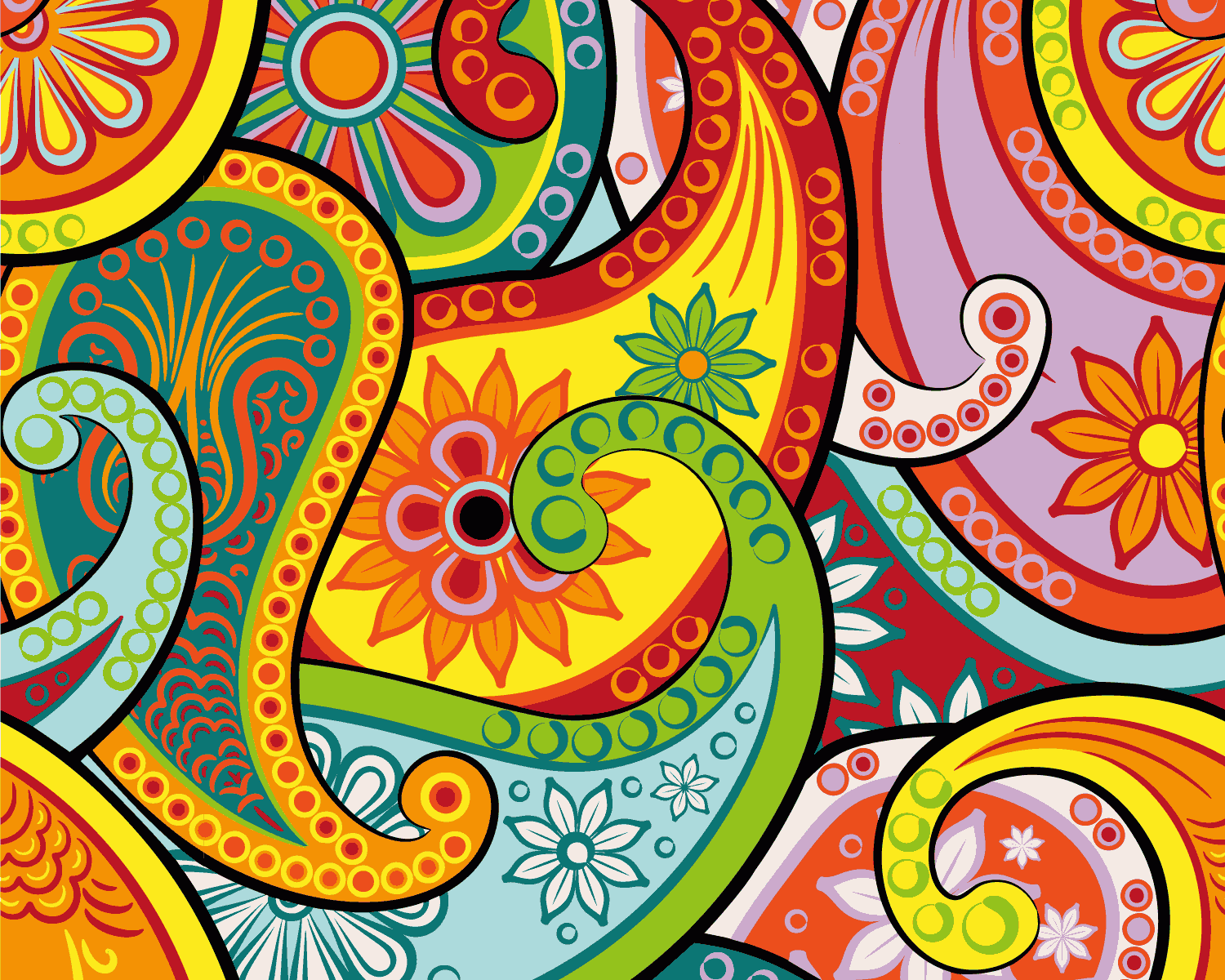Die Sonne scheint und es wird warm. Da gibt es nichts Schöneres, als ein entspanntes Picknick im Freien.
Es ist die ideale Möglichkeit, um die Natur zu genießen, sich zu entspannen und leckere Köstlichkeiten zu essen.
Damit Ihrem nächsten Picknick nichts mehr im Wege steht, haben wir einige hilfreiche Tipps für Sie zusammengestellt.
1. Auswahl der richtigen Location
Damit das Picknick ein schönes Erlebnis wird, ist die Wahl des richtigen Ortes entscheidend. Suchen Sie nach einem Ort mit ausreichend Schatten, einer schönen Aussicht und genügend Platz, um sich auszubreiten und zu entspannen.
Strand, Park oder Seeufer – das alles sind perfekte Orte für ein idyllisches Picknick.

2. Die richtige Vorbereitung
Erstellen Sie sich vor dem Picknick eine Checkliste mit allen Dingen, die Sie brauchen:
- Lebensmittel
- Getränke
- Besteck
- Servietten
- Decken
- etc.
Die Picknickkörbe und Picknickrucksäcke von anndora sind schon mit dem notwendigen Zubehör für bis zu vier Personen ausgestattet. So müssen Sie weniger organisieren und können sich einfach auf das Picknick freuen.
3. Leckeres Essen und Getränke vorbereiten
Das Essen ist das Herzstück eines perfekten Picknicks. Bereiten Sie eine Vielzahl von leckeren Snacks, Sandwiches, Salaten und süßen Leckereien vor.
Nehmen Sie außerdem ausreichend Getränke mit. Wasser, Kaffee oder eine erfrischende Fruchtbowle eignen sich ideal für ein Picknick.
Packen Sie das Essen in eine Kühltasche, damit es frisch und kühl bleibt.
Anndora hat auch hier eine große Auswahl an verschiedenen Kühltaschen in jeder Größe.
4. Weiteres Zubehör nicht vergessen
Damit das Picknick für Sie stressfrei bleibt, ist es zu empfehlen, dass Sie praktisches Zubehör mitnehmen.
Eine Picknickdecke zum Sitzen, isolierte Behälter für heiße oder kalte Speisen, ein Flaschenöffner, ein Korkenzieher und Müllsäcke gehören zu den unverzichtbaren Utensilien.
Vergessen Sie zudem nicht, sich mit Sonnencreme einzucremen und Insektenschutz einzupacken, damit Sie das Picknick sorgenfrei genießen können.
5. Sorgen Sie für Unterhaltung
Neben gutem Essen und schöner Natur sorgt auch die richtige Unterhaltung für ein gelungenes Picknick. Packen Sie ein Frisbee, einen Fußball, ein Kartenspiel oder ein Buch ein, um die Zeit im Freien zu genießen.

Mit der richtigen Planung, köstlichen Speisen und praktischem Zubehör wird Ihr nächstes Picknick zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Picknick im Regen – auch das ist möglich!
Bei anndora finden Sie eine große Auswahl an Kühltaschen und Picknickkörben, mit denen Ihr nächstes Picknick garantiert ein Erfolg wird.